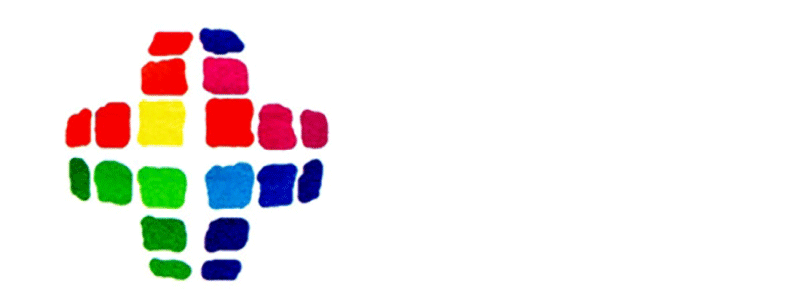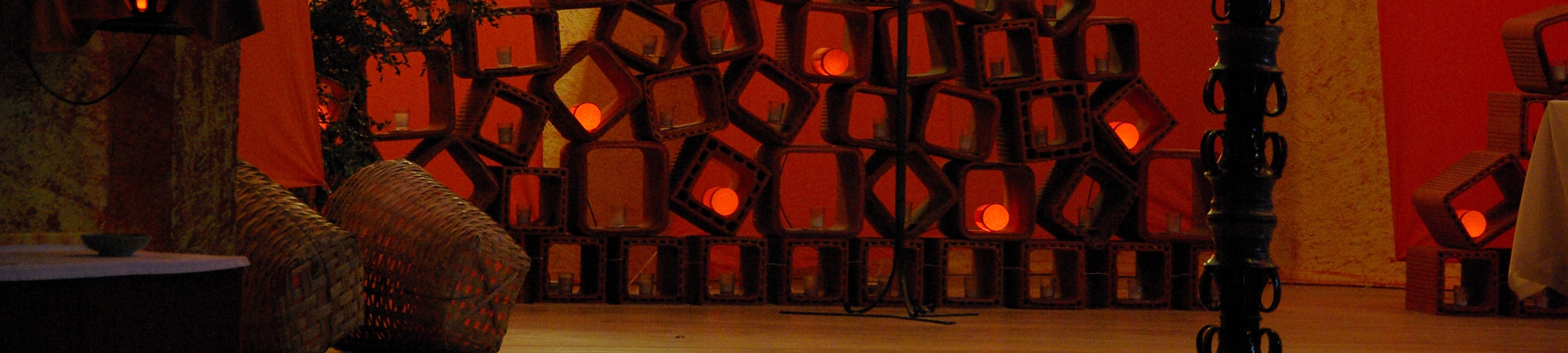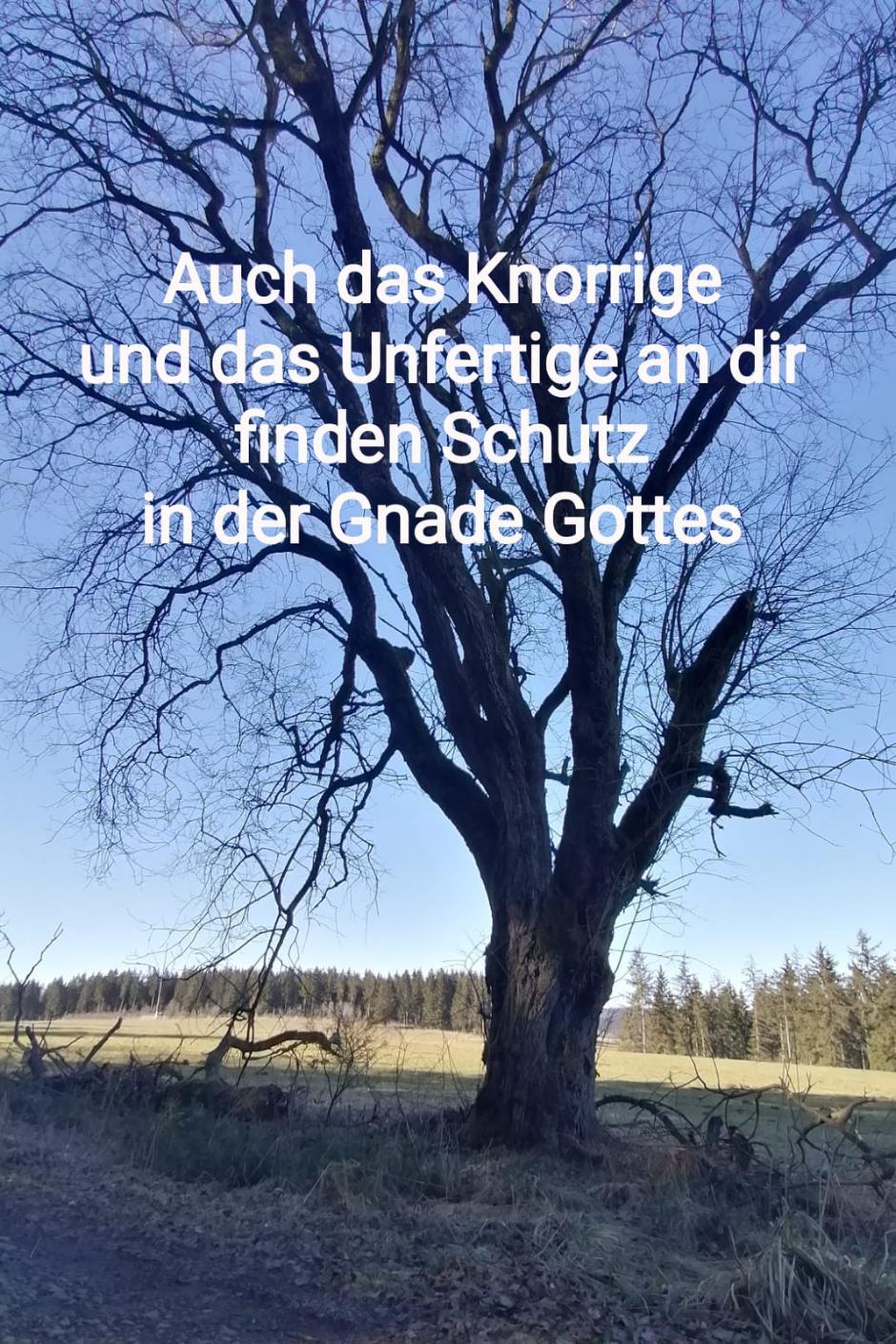Gemeinde leben
Neu in unser GdG: Das "Lied des Monats"
Jeden Monat wollen wir in den Gottesdiensten unserer GdG Blankenheim/Dahlem ein anderes neues Lied aus dem Gotteslob einüben aufdass unser "Liederschatz" an bekannten Lieder in den Gemeinden erweitert werden kann.
Auf dieser Seite finden Sie die jeweiligen "Monatslieder" inklusive eines beschreibenden Textes sowie einer Aufnahme mit Hilfe derer Sie das Monatslied auch bei sich zu Hause üben und singen können.
Viel Spass damit!
Dezember: "Ave Maria, gratia plena" - GL 537
November: "Da wohnt ein Sehnen" - GL 799
Kalt, neblig und grau, so kommt häufig der Monat November daher und stimmt einen - vor allem im Zuge von Allerseelen, Volkstrauertag und dem Ende des Kirchenjahres - doch eher nachdenklich. Eine Sehnsucht keimt auf nach Trost und Geborgenheit, nach Zuversicht und Hoffnung. In diese Stimmung passt das Lied, dass die britische Komponistin Anne Quigley im Original als "There is a longing" dichtete und in der deutschen Übersetzung von Eugen Eckert als "Da wohnt ein Sehnen tief in uns" seinen Weg in das neue Gotteslob fand. Die Strophen zählen alles auf, wonach wir uns sehnen: Nach Frieden, nach Freiheit, nach Heilung und vielem mehr. Die größte Sehnsucht findet sich allerdings in der letzten Strophe. Der Durst nach Gott selbst: "Sei da, sei uns nahe Gott". "Wer die tiefste Sehnsucht nicht verschüttet, sondern sie zulässt und aushält, der sucht nach Gott" so schreibt Sr. Theresia Hegermann. Probieren wir es aus und bitten um Gottes Nähe in dunkler Zeit.
Oktober: "Herr, dich loben die Geschöpfe" - GL 467
Am 4. Oktober feiern wir den Gedenktag des Heiligen Franz von Assisi. Der von ihm bekannte "Sonnengesang" ist einer der ältesten überlieferten Texte in der italienischen Volkssprache und stammt aus dem 12. Jahrhundert. Angeregt durch Psalm 148 und das Buch Daniel wird in ursprünglich 14 Strophen das Lob besungen auf Gottes Schöpfung, die Gestirne, die vier Elemente Luft, Wasser, Feuer, Erde, das Leben und den Tod. All das lässt sich auch in den fünf Strophen unseres Monatsliedes wiederfinden, zwar sehr komprimiert aber dennoch vollständig. Jede Strophe endet zudem mit dem allgemeinen Ausruf "Alle Schöpfung lobt den Herrn" - stimmen also auch wir mit ein in diesen Lob- und Freudengesang auf Gottes wunderbares Werk.
September: Größer als alle Bedrängnis - GL 962
Das Lied, das ursprünglich aus dem Erzbistum Freiburg stammt, komponierte Barbara Kolberg im Jahr 2008. Große Sprünge in der Melodie und ein weiter Tonumfang von ganz hohen zu ganz tiefen Tönen geben den Anschein, als wollte sie in ihrem Lied Himmel und Erde verbinden. Gott neigt sich herab, dem Menschen in seiner Not Zuspruch zu schenken. „Größer als alle Bedrängnis“ – egal, was sich im Leben ereignet, Gott steht immer über den Dingen, kennt einen Plan, der unser eigenes Denken übersteigt. „Dein Leben will singen aus Tod und Misslingen. Dein Leben will brechen aus unseren Schwächen“ so dichtet Silja Walter und schenkt uns damit Hoffnung, dass es in Zeiten größter Ratlosigkeit und Verzweiflung dennoch weitergeht durch Jesus Christus selbst, denn „sein Herz will sich geben uns selber zum Leben. Halleluja“.
August 2023: Geborgen in dir Gott - GL 786
Von Christoph Lehmann, dem Komponisten dieses Liedes, stammen u. a. auch die bekannteren Lieder „Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt“ und „Da berühren sich Himmel und Erde“. Auch wenn die Melodie unseres neuen Monatsliedes im ersten Moment etwas schwieriger erscheint, wird auch hier der Refrain schnell zu einem neuen Ohrwurm.
Der Text spendet Zuversicht und Trost, indem dazu eingeladen wird, sich ganz in Gottes Arme fallen zu lassen, Ruhe zu finden in „Mutters Schoß“. Gerufen von dir, wie es in der zweiten und dritten Strophe heißt, kann ich mich selbst finden und mich selbst bejahen. Sobald ich Gottes Ja erwidere, mich an seiner Hand durch den Tag leiten lasse, entsteht eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Gott und Mensch gleichwie zwischen einer Mutter und ihrem Kind.
Juli 2023: Aus meines Herzensgrunde / Ich liege Herr, in deiner Hut - GL 86 / GL 99
Gleich zwei Lieder begegnen uns im Monat Juli neu: Ein Morgen- und ein Abendlied je nach passendem Anlass!
„Aus meines Herzens Grunde“ (GL 86)
Als "Neues Geistliches Lied" taucht "Aus meines Herzens Grunde" erstmals im Jahr 1589 in einem Gesangbuch auf. Und obwohl der Text auf Luthers Morgensegen basiert, findet es sich auch schon seit dem 17. Jahrhundert immer wieder in katholischen Gesangbüchern - bis heute. Während die ersten beiden Strophen rückwirkend für Bewahrung in der Nacht danken, ist die dritte Strophe auf den anbrechenden Tag gerichtet mit der Bitte um Gottes Beistand und Segen. Mit der letzten Strophe legt der Singende noch einmal bewusst und mit Dank alles in Gottes Hand, um sich daraufhin freudig an sein Tagwerk zu begeben.
„Ich liege Herr, in deiner Hut“ (GL 99)
Jochen Klepper schrieb den Liedtext am 7. Mai 1938 und bezog sich dabei auf Gebetsworte aus Psalm 4. Die Situation in dem Lied beschreibt die eines Kindes, das in den Armen von Mutter oder Vater in den Schlaf gewiegt wird, wobei die wiegenden Arme hier zu Gott gehören. Das Lied spendet Trost und Zuversicht, wenn die Gedanken abends vor dem Einschlafen nicht zur Ruhe kommen wollen. Da Jochen Klepper mit einer jüdischen Frau verheiratet war, plagten ihn zur Entstehungszeit heftige Alpträume und Schlafprobleme. Ein Tagebucheintrag verrät: "Die dritte Nacht ohne Schlafmittel überstanden. Es muss um des Abendliedes (...) willen sein" In schwierigen Zeiten nicht an Gott zu verzweifeln, sondern sich in seine Arme zu werfen, ist die Grundaussage der elf abgedruckten Strophen, die auch ohne Melodie zu einem heilsamen Abendgebet werden.
Juni 2023: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott - GL 453
Die eingängige Melodie gehört ursprünglich zu einem Lied, das der schwedische Theologe Anders Ruuth 1968 während seiner Zeit als Professor in Buenos Aires schrieb. Der spanische Text lautet wortwörtlich übersetzt:
"Der Friede des Herrn, der Friede des Herrn,
der Friede des Auferstandenen:
der Friede des Herrn wird dich und mich, wird alle erreichen."
Eugen Eckert, von dem die heutige Version im Gesangbuch stammt, wandelte schließlich den Friedensruf des Auferstandenen in seiner neuen Dichtung zu einem umfassenden Segenstext. Die ersten beiden Strophen beziehen sich dabei auf Gott Vater, den Schöpfer, mit Bildern aus dem Alten Testament. Die dritte Strophe spielt auf das "Vaterunser" an ("bewahre uns vor allem Bösen") und die vierte Strophe erinnert an den Leben spendenden Geist. Und so spendet das Lied Trost und Zuversicht nicht nur bei Taufen und Trauungen, sondern auch an allen Sonntagen des Kirchenjahres.
Dezember: Herr send herab uns deinen Sohn - GL 222
Das Lied greift in seiner 2. bis 8. Strophe die O-Antiphonen auf, die mindestens seit dem 7. Jahrhundert gebetet werden. In den Heiligen Messen wird in der Zeit vom 17. bis 23. Dezember jeweils eine O-Antiphon im Ruf vor dem Evangelium gesungen. Darin wird in Bildern, die dem Alten Testament entnommen sind, der Messias um sein Kommen angefleht. Die sieben O-Antiphonen lauten: O Weisheit (17.12.), O Adonai (18.12.), O Spross aus Isais Wurzel (19.12.), O Schlüssel Davids (20.12.), O Morgenstern (21.12.), O König aller Völker (22.12.) und O Immanuel (23.12.).
Die verwendeten alttestamentlichen Bilder sind für uns heute, die wir zum großen Teil den Kontakt zur jüdischen Tradition verloren haben, nicht mehr so leicht zugänglich. Trotzdem ist auch heute noch die tiefe Sehnsucht spürbar, die aus diesen Anrufungen und den damit verknüpften Bitten spricht. Diese Sehnsucht wird nicht laut herausgeschrieen, sondern jeweils mit einem tiefen Seufzen, dem „Oh“ eingeleitet. Dadurch erhalten sie einen ruhigen, fast meditativen Charakter. Die O-Antiphonen werden im Lied Nr. 222 mit der einleitenden 1. und der abschließenden 9. Strophe im Licht der christlichen Hoffnung gedeutet. Der Kehrvers „Freu dich, freu dich o Israel“ bringt zum Ausdruck, dass die Erfüllung der Sehnsucht bereits für die nahe Zukunft erwartet wird, sodass die Sehnsucht sich bereits in Vorfreude verwandelt.
November: Ein Funke aus Stein geschlagen - GL 787
Das von Gregor Linßen komponierte und getextete Lied „Ein Licht in dir geborgen“ ist ein Lied wie eine Übergangsjacke, perfekt für diese wechselhafte Zeit im Jahr. Der Text spielt mit den Gegensätzen, die gerade auch den Monat November prägen: Die erste Strophe beginnt mit den Worten „Ein Funke aus Stein geschlagen“ – Ja, es ist uraltes Wissen, dass kalte Steine und wärmendes Feuer sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern dass das eine das andere erzeugen kann. Im November wärmen wir uns besonders gerne am „Feuer in kalter Nacht“, vor allem bei den Feiern zu Sankt Martin. Weitere Gegensatzpaare in diesem Lied sind Glut und Wasser, Strahl und Wolken, lachende Augen und blinde Wut, Kraft und tiefe Not, Nacht und Morgen, Angst und Kraft zum Neubeginn.
Das Lied will Hoffnung machen, dass jede Not in sich schon den Schlüssel zur Lösung des Problems beinhaltet. Der November, der von vielen Menschen als besonders trister Monat erlebt wird, weil das Wetter kalt und die Landschaft kahl wird, regt zum Nachdenken über den Tod an. Das spiegeln besonders die Feiertage Allerheiligen und Allerseelen sowie der Volkstrauertag. Doch so wie Christen glauben, dass der Tod der Anfang der Auferstehung ist, so beginnt am letzten Novemberwochenende auch schon das neue Kirchenjahr mit dem ersten Advent, mit dem Warten auf das Fest der Geburt Jesu, mit der ersten Kerze auf dem Adventskranz. (Kerzen-) Funke und (Grab-) Stein, der November kann beides. „Ein Licht in dir geborgen“ ist ein Lied, das beide Seiten des Novembers miteinander verbindet.
Oktober: Ave Maria zart, du edler Rosengart - GL 527
Im Rosenkranzmonat Oktober werden wieder verstärkt Marienlieder gesungen. Neben den beliebten Evergreens wie „Segne du, Maria“ oder „Wunderschön Prächtige“ gibt es da noch einige halbvergessene alte Schätze zu entdecken. Eine dieser Wiederentdeckungen ist unser Monatslied „Ave Maria zart“, das eher selten gesungen wird, obwohl es sogar im Hauptteil des Gotteslobs steht. Geschrieben und komponiert wurde dieses Lied im 17. Jahrhundert von dem böhmischen Kirchenmusiker Johann Georg Franz Braun, der Mitglied in einer von Jesuiten geleiteten marianischen Bruderschaft war.
Der Liedtext orientiert sich stark am wichtigsten Mariengebet, dem „Gegrüßet seist du Maria“, dessen erste Hälfte wiederum aus Bibelzitaten zusammengesetzt ist: Aus den Worten des Engels Gabriel „Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.“ (Lk 1,28) und aus den Worten Elisabeths „Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.“ (Lk 1,42) Die erste Strophe des Liedes erinnert an den Gruß des Engels, die zweite und dritte Strophe heben die heilsgeschichtliche Bedeutung der Geburt Jesu hervor („der unser Retter ist / aus aller Sünd und allem Schaden“) und die vierte Strophe schließlich ist an den Abschluss des „Gegrüßet seist du Maria“ angelehnt, indem Maria um ihre Fürsprache gebeten wird. So ist dieses Lied, das ursprünglich einmal als Adventslied abgedruckt wurde, auch ein sehr passender Begleiter zum Rosenkranz, der ja im Wesentlichen aus der Wiederholung des „Gegrüßet seist du Maria“ besteht.
September: Dir sei, o Gott, für Speis und Trank - GL 779
Ab Ende September und bis zum ersten Oktoberwochenende begehen wir in der Kirche das Erntedankfest. Dank für die Ernte, für unsere Nahrung, für alles was wir zum Leben brauchen, und Vertrauen, dass Gott „auch künftig geben“ wird: Alle diese Gedanken kommen nicht nur im Erntedankfest, sondern auch in jedem Tischgebet zum Ausdruck. Eins dieser Tischgebete hat Klaus-Ewald Fischbach vertont. Es fällt vielen Menschen nicht leicht, ausgerechnet in unserer Zeit dankbar zu sein. Zu bedrückend erscheinen die vielen Krisen unserer Tage: Naturkatastrophen, Seuchen, Kriege, Hungersnöte in vielen Teilen der Welt, Inflation auch hier bei uns. Die Schlangen bei den Tafeln, wo Bedürftige sich für wenig Geld mit Lebensmitteln versorgen können, werden immer länger. Der Dank für das Gute bedeutet jedoch nicht, die Augen vor der Not zu verschließen. Und umgekehrt bedeutet Leiden an manchen Missständen nicht, dass ich nicht trotzdem auch dankbar sein kann. Beides schließt sich gegenseitig nicht aus. Sondern wenn diese beiden Waagschalen im Gleichgewicht sind, dann bin ich fähig zu handeln, um Not zu lindern, weil das Entsetzen mich nicht mehr lähmt. Weil ich dann die Hoffnung habe, dass es sich lohnt zu handeln, weil Gott es doch letztlich gut mit uns meint.
August: Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen - GL 452
Der Refrain des Liedes nimmt Bezug auf den aaronitischen Segen aus Num 6,24ff., der da lautet: „Der HERR segne dich und behüte dich. Der HERR lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der HERR wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden.“ Diesen Segen verwendete der Franziskanerpater Helmut Schlegel OFM als Ausgangspunkt zu einem längeren Liedtext. Das Lied verknüpft diesen Segen mit der Freude an der Schöpfung, wie sie auch im Sonnengesang des Franz von Assisi ausgedrückt ist. In der ersten Strophe heißt es: „Der Herr ist Gott, er schuf das Universum, er hauchte Leben ein in Meer und Land. Er schuf auch dich und gab dir einen Namen. Geschrieben stehen wir in Gottes Hand.“ Sowohl Geborgenheit als auch Weite sprechen aus diesen Zeilen. Geborgenheit im väterlich-mütterlichen Gott, aber auch Verbundenheit mit der weiten Welt, mit dem ganzen Universum. In diesem weiten Universum kann ich auch selbst etwas säen und so mitwirken an der Schöpfung (2. Strophe), kann liebevoll in Beziehung treten zu anderen Menschen (3. Strophe), muss ich manche Dunkelheiten durchleben (4. Strophe), werde schuldig (5. Strophe), und darf in Gemeinschaft mit anderen dankbar sein (6. Strophe). So bringt dieses Lied mein ganzes Leben mit allen Höhen und Tiefen vor Gott und stellt es unter Gottes Segen. Die Melodie von Thomas Gabriel bringt diesen Rhythmus des Lebens, die Höhen und Tiefen und das Gefühl von Vertrauen auch musikalisch zum Ausdruck.
Monat Juli: Das Jahr steht auf der Höhe - GL 465
Nicht lang ist es her, da hatten wir mit dem 21. Juni bereits den längsten Tag und die kürzeste Nacht des Jahres erreicht. Das Jahr steht auf der Höhe in voller Blüte, die Tage bescheren uns heißes Wetter und der Urlaub steht kurz bevor. Und doch werden die Nächte schon wieder kürzer, Abschied und Vergänglichkeit sind Thema unseres Juli-Monatsliedes. "Das Jahr lehrt Abschied nehmen schon jetzt zur halben Zeit" so heißt es in der 3. Strophe. Wie passt das zueinander: Sommer, Sonne, Ferienzeit und dann mittendrin der "vergehende" Mensch? Der Johannestag am 24. Juni offenbart uns die Botschaft: "ER muss wachsen, ich aber muss abnehmen" (Joh 3,30). Statt nach dem Vergänglichen zu streben, sollen wir lernen loszulassen. Der Liedtexter Detlev Block schreibt selbst: "Hier dachte ich an Gott als Erfüllung im Hier und Heute und zugleich als Erfüllung im Dann und Dort. Nur unter dieser Perspektive können wir das Loslassen hoffnungsvoll lernen." Daher endet das Lied auch mit der Bitte: "Gib, eh die Sonne schwindet, der äußere Mensch vergeht, dass jeder zu dir findet und durch dich aufersteht."
Christina Kothen