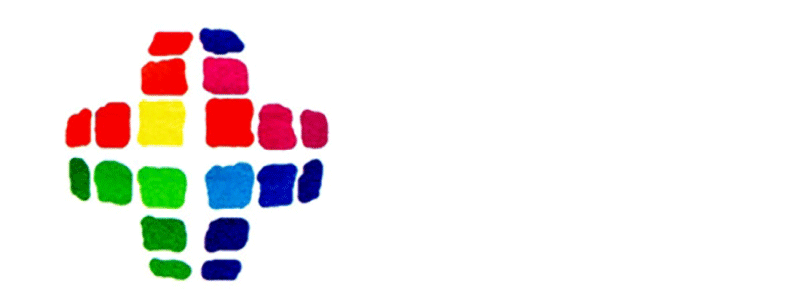Vom Geist der Liturgie
Die Feier der Heiligen Messe neu entdecken
"Die Heilige Messe neu entdecken..." - Was meint das? Und wozu das Ganze?
Als ich vor einigen Jahren eine Lektüre für den Urlaub suchte, fiel mir das Buch „Vom Geist der Liturgie“ in die Hände. Während ich das Buch las, weitete und vertiefte sich mein Blick für das, was wir dort jeden Sonntag in der Heiligen Messe tun. Ich war fasziniert von der Fülle dessen, was dort geschieht und wie fruchtbringend es für das „Mitfeiern“ der Messe sein kann, dies zu wissen, diesen „Geist der Liturgie“ zu entdecken und zu spüren.
Was passiert dort, warum sind die Abläufe im Gottesdienst so, wie sie sind?
Was haben die einzelnen Zeichen, Riten oder Gebräuche für eine Bedeutung?
Um das Anliegen der Glaubenswoche unter dem Motto „Komm und sieh!“ aufzugreifen, ist es mir ein Herzensanliegen, Sie an meiner Erfahrung teilhaben zu lassen und in mehreren Teilen, die von nun an jeden Monat hier auf unserer Homepage veröffentlicht werden, von diesem „Geist“, von dieser Tiefe und Fülle der Heiligen Messe zu berichten.
Hinzu gibt es das Angebot, diesem "Geist der Liturgie" auch mit den Ohren näher zu kommen und dem vorgetragenen Text zu lauschen.
Also: „Komm und sieh!“ – oder „Komm und lese!“ oder auch "Komm und höre!"
Ihr Nils Kothen
Vom Geist der Liturgie - Die Heilige Messe neu entdecken
Das Betreten des Kirchraums vor der heiligen Messe, scheint auf den ersten Blick recht banal. Wir treten in die Kirche ein, nehmen uns ein Gottlob, vielleicht auch ein Papier vom Schriftenstand, suchen uns einen Platz in einer der vielen Bänke, sprechen möglicherweise noch ein kleines Gebet und fühlen uns danach für die eigentliche Messe gut vorbereitet. Doch was in diesen kleinen Handlungen auf den ersten Blick banal und selbstverständlich erscheint, geht in seiner Bedeutung und Symbolik sehr tief und ist unverzichtbar für das kommende, für die heilige Messe.
Es beginnt mit dem Übertreten der Schwelle des Kirchenportals, mit dem Eintritt in den Kirchraum. In was treten wir da eigentlich ein? Wir treten ein in einen „Raum“ der mehr ist als ein Versammlungsraum für den Gottesdienst. Er ist Abbild unseres Glaubens, Raum gewordenes Glaubensbekenntnis. Er ist nicht einfach gemacht, sondern aus der vorchristlichen Synagoge, sowie dem Jerusalemer Tempel heraus in einer über 2000jährigen Geschichte der Beziehung Gottes zu seinem Volk gewachsen. Somit betreten wir nicht nur einen „Raum“, sondern treten ein in eine lange Geschichte des Glaubens und der Glaubenden, werden selbst Teil dieser Gemeinschaft des Glaubens, die wir Kirche nennen.
Nehmen wir diesen Gedanken ernst, so passiert noch etwas. Wir verlassen die Zeit unseres Alltags und begeben uns in einen „Raum“, der sowohl Vergangenheit, Gegenwart, als auch Zukunft gleichzeitig ist. Die Vergangenheit begegnet uns in der Gemeinschaft der Glaubenden, die vor uns gelebt haben, den Seligen und Heiligen. Sichtbar wird dies in den Heiligenbildern und -statuen, sowie in den Apostelleuchtern die wir als kleine Kreuze mit einer Kerze an der Wand einiger Kirchen wahrnehmen. Die Kirche ist gebaut auf bzw. mit Hilfe der Apostel, deren Grundstein Jesus Christus ist, der Stein, den die Bauleute verwarfen, der nun aber zum Eckstein geworden ist. Die Gegenwart begegnet uns in unserem Gegenüber und in uns selbst, die wir Teil der Kirche sind. Die Zukunft begegnet uns in Jesus Christus, gegenwärtig im Brot, in der Hostie, die im Tabernakel ruht und auf die unser Blick fällt, wenn wir aus der Bank nach vorne schauen. Der Blick nach vorne führt uns der Zukunft entgegen.
Früher war es üblich, die Kirche nach Osten hin auszurichten. Der Altar einer Kirche sollte im Osten liegen, damit sich die Gläubigen der aufgehenden Sonne zuwenden konnten. Diese aufgehende Sonne ist bis heute Symbol für Christus, den Auferstandenen, der uns aus der Nacht (Symbol für Tod und Vergangenheit) dem Tag (Symbol für das ewige Leben) entgegenführt. Blicken wir also auf Altar und Tabernakel, so schauen wir auf Jesus Christus, unsere Sonne, richten uns auf ihn hin aus, um durch ihn der Zukunft bei Gott entgegenzugehen. Dass dies allerdings wirklich Zukunft ist, also noch kommt, zeigt sich darin, dass wir uns der aufgehenden Sonne, der Morgenröte zuwenden.
Nach dem Eintreten in diesen „Raum“ der die Zeiten übersteigt und mehr ist als ein Versammlungsraum, vollziehen wir, meist unbewusst, eine zweite symbolische Handlung. Wir tauchen die Hand in Weihwasser (vor Beginn der Corona-Pandemie) und bekreuzigen uns.
Das Kreuzzeichen zu den Worten „im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes“ soll uns an unsere Taufe erinnern, durch die wir zum Herrn gehören, mit der unsere Beziehung zu Gott begann und durch die wir damals in „die Gemeinschaft der Kirche“, die wir nun betreten haben, aufgenommen worden sind. Bekräftigt wird diese „Tauferinnerung“ durch die Verwendung von geweihtem Wasser. Sooft wir das Kreuzzeichen machen, nehmen wir unsere Taufe neu an und machen uns klar, dass wir durch den Heiligen Geist zu Christus geführt werden, der uns die Tür zum Vater, zu Gott hin öffnet. Dieser Gott ist nun nicht mehr ein unbekannter, sondern einer, der einen Namen hat, den wir anrufen, dem wir begegnen können. Und genau deshalb versammeln wir uns zur heiligen Messe, um Gott in Wort und Sakrament durch den heiligen Geist in Christus zu begegnen. Kann es also ein besseres vorbereitendes Symbol, eine bessere vorbereitende Handlung als das Kreuzzeichen vor jedem Gottesdienst geben?
Dieses „Eintreten“ in diesen „Raum“, in diese „Zeit“, braucht Vorbereitung, braucht Ruhe, braucht eben jenes, in das wir selbst Eintreten: Zeit. Mir persönlich hilft es daher, 10-15 Minuten vor Beginn der Messe da zu sein, zu beten und diese Symbole, diese Handlungen mehr oder weniger bewusst, zu vollziehen, um in dieser göttlichen Zeit, in diesem göttlichen Raum anzukommen und ein Teil desselben, des großen Ganzen zu werden. Dann kann es mir gelingen Gott, in Wort und Sakrament würdig und aufmerksam zu begegnen.
Es beginnt mit einem Läuten, mit dem Läuten einer Glocke. Dieses Läuten ruft eine Reaktion bei uns hervor: Wir stehen auf, erwarten den Einzug des Priesters, der Messdiener und das feierliche Spiel der Orgel. Diese Glocke, die uns ruft, ist nicht groß, doch ihr Klang ist auffordernd genug, um eine ganze Gemeinde zu kommandieren. „Steht auf, bereitet euch zu Gebet und Gottesdienst!“ Am Anfang steht also eine Aufforderung. „Wer Ohren hat, der höre!“ und um das Folgende vorwegzunehmen: „Wer Füße hat, der gehe!“ Unsere Erwartungen werden nicht enttäuscht. Als erstes erblicken wir das Kreuz, dann die Messdiener und schließlich den Priester. Sie schreiten zum Altar, den sie mit einer Kniebeuge verehren. Auch wenn wir in der Bank stehen bleiben, nicht mit nach vorne gehen, so sind wir doch ein Teil dieser kleinen Prozession. Wir alle machen uns auf den Weg, wir alle setzen uns in Bewegung, wir alle gehen auf den Herrn zu, gehen ihm entgegen und begrüßen ihn, heißen ihn willkommen und wollen ihm in Wort und Sakrament begegnen. Soweit so gut, doch da ist etwas, das in dieses Bild nicht passt, unstimmig wirkt. Wenn wir dem Herrn entgegengehen, warum geht er uns dann in Form des Vortragekreuzes, das der erste Messdiener trägt, voraus? Geht er mit oder gehen wir ihm entgegen? Beides! In seiner Auferstehung ist er uns ans Ziel schon vorausgegangen, wartet auf uns und heißt uns in seinem Reich willkommen. Aber zugleich ist er auch immer mit uns auf dem Weg, steht uns zur Seite und ist unser Begleiter. Er selbst geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn er sagt: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“. Erinnern wir uns: Im Kirchraum vereinen sich die Zeiten Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Aber zurück!
Denkt man an die großen Prozessionen der Bischöfe, Kardinäle und schließlich des Papstes beim Einzug in „ihren“ Dom, so kann man zu der Vermutung gelangen, es handle sich um eine schillernde Inszenierung des Auftrittes, des Erscheinens des Hauptdarstellers der ganzen Veranstaltung. Nahrung erhält diese Vermutung durch die leuchtenden und kunstvollen Gewänder, mit denen sich der Geistliche „schmückt“ und die ihn von der restlichen Gemeinde abheben. Diese Vermutung läuft in die Irre. Das „liturgische Kleid“, wie man die Bekleidung des Priesters nennt, hat eine andere Aufgabe. Es soll deutlich machen, dass er hier nicht als Privatperson, als dieser oder jener da ist, sondern an der Stelle eines anderen steht – Christus. Sein bloß Privates, Individuelles soll verschwinden und Christus Raum gegeben werden. „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.“ Dieses Wort aus dem Munde des Apostels Paulus hat für den zelebrierenden Priester eine ganz spezifische Geltung. Nicht er selbst ist wichtig, sondern Christus. Nicht sich selbst und seine Ideen teilt er den Menschen mit, sondern Ihn, den Auferstandenen. Er macht sich zum Werkzeug für Christus und handelt nur als sein Bote, als sein Stellvertreter.
Doch mit dem Läuten der Glocke, dem Einzug des Priesters und seiner Helfer, stellvertretend für die versammelte Gemeinde und der Verehrung des Altars durch eine Kniebeuge, hat die eigentliche Feier noch gar nicht begonnen. Der eigentliche Beginn zeichnet sich (neben dem Kreuzzeichen) durch etwas ganz Alltägliches aus, etwas, mit dem auch wir jede Begegnung, jedes Gespräch beginnen: Mit einem Gruß. „Der Herr sei mit euch!“ – „Und mit deinem Geiste!“ Ein Gruß baut eine Brücke von Mensch zu Mensch und zollt dem jeweiligen Gegenüber Ehre und Respekt, die Grüßenden nehmen sich gegenseitig an, wie sie sind. Der hier verwendete „liturgische Gruß“ geht sogar noch einen Schritt weiter. Er spricht neben der Respektsbekundung zusätzlich noch eine Bitte aus: Seid alle vom Herrn erfüllt, gesegnet und für das Kommende, die Begegnung mit dem Herrn, bereitet.
Nachdem sich die Feiernden gegenseitig in diesem gemeinsamen Wusch angenommen haben, gilt es nun, sich für die Begegnung mit dem Herrn, mit Christus vorzubereiten. Dies geschieht in zwei Schritten. Wenn wir einen Gast in unserer Wohnung empfangen, richten wir diese meist fein und ordentlich her. Wir bereiten alles vor und schaffen Schmutz, Unrat und Unordnung beiseite. Genau das gleiche trifft auf die Gemeinde zu Beginn der heiligen Messe zu. Unser Gast ist Jesus. Die Wohnung, in der er zu Gast sein will, sind wir selber, unser Leib, unsere Seele, unser Herz. Bevor wir Jesus eintreten lassen können, müssen wir dort aufräumen, allen Schmutz und Unrat bereinigen. Dies geschieht durch das Bekennen und die darauf folgende Vergebung unserer Sünden, unseres Unrates. Dazu sprechen wir das Schuldbekenntnis: „Ich bekenne Gott dem Allmächtigen…“. Nachdem wir unsere Wohnung bereitet haben, folgt der zweite Schritt. Wir öffnen die Tür und begrüßen den sich nähernden Gast. Es ist ein ehrenvoller Gruß, ein Willkommensruf: „Kyrie – eleison! Christe – eleison! Kyrie – eleison!“ – „Herr, erbarme dich! Christus, erbarme dich! Herr, erbarme dich!“ Ursprünglich war das Kyrie ein Huldigungsruf, der dem römischen Kaiser oder auch einem heidnischen König gewidmet war. Das frühe Christentum widersetzte sich der gottähnlichen Huldigung des Kaisers. Ihr alleiniger Herr, ihr alleiniger Kyrios (das heißt übersetzt Herr) war Christus, der Auferstandene. Im Laufe der Jahrhunderte verlagerte sich die Deutung des Kyrie. Aus dem Huldigungsruf wurde eine flehende und bußfertige Bitte um Annahme der eigenen sündigen Person durch Christus, den Kyrios. Heute kann das „Kyrieeleison“ auf zweierlei Arten verwendet werden, als Vergebungsbitte, als Bereiten, oder als Huldigungsruf. Ist letzteres der Fall, so muss vorher allerdings eine andere Form der Vergebungsbitte, z.B. das Schuldbekenntnis erfolgt sein, sonst wäre das Zimmer, die Kammer des Herzens schließlich noch nicht aufgeräumt und bereitet.
In den meisten Zeiten des Kirchenjahres schließt sich an die erste Begrüßung, das Kyrie, noch ein zweiter, jubelnder, frohlockender, sich freuender, weihnachtlicher Gruß. Das „Gloria“. Es ist eine sehr passende Form der Begrüßung, wenn man die ersten Worte des Gloriatextes ernst nimmt: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade“. Diese Zeile entstammt dem Weihnachtsevangelium nach Lukas. Die Engel grüßen die Hirten auf den Feldern und kündigen ihnen damit die Ankunft des Sohnes Gottes auf Erden, dieses himmlischen Gastes an. Und auch wir grüßen Jesus, freuen uns über seine Ankunft in unserer Mitte und drücken dies singend und jubelnd durch eben jene Worte aus, die die Engel an die Hirten richteten. „Gloria in excellsis Deo!“ Gibt es einen würdigeren Empfang, eine würdevollere Begrüßung für Christus, den Sohn Gottes, den Herrn, unseren Kyrios, als durch die Worte der Engel?
Nun ist Christus angekommen. Er ist in unserem Haus zu Gast und richtet als erstes, in der stellvertretenen Gestalt des Priesters, der „Christus angezogen“ hat, symbolisiert durch das liturgische Kleid, mit der ganzen Gemeinde ein gemeinsames Gebet an seinen himmlischen Vater: Das Tagesgebet. „Lasset uns beten!“ – Die Begegnung mit dem Herrn, dem Kyrios, hat begonnen.